Wer in Tübingen Politikwissenschaft studiert hat, ist an Dr. Rolf Frankenberger nicht vorbeigekommen. Seit fast 20 Jahren ist er vom Institut für Politikwissenschaft nicht wegzudenken, bald kommt seine Zeit dort jedoch zu einem Ende. Im Interview spricht er über die Studierenden von heute, das Verhältnis zwischen Politik und Politikwissenschaft und über seine neuen Aufgaben am neuen Institut für Rechtsextremismusforschung.
Wie fassen Sie Ihre bisherige Tätigkeit am Institut für Politikwissenschaft zusammen?
Ich bin jetzt seit 1997 an dieser Uni, weil ich hier auch studiert habe. Ab 2003 habe ich hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft gearbeitet, promoviert, und bin dann danach auf eine über Studiengebühren und Qualitätssicherungsmittel finanzierte Stelle gekommen. 2009 habe ich dann eine Dauerstelle bekommen. Von Lehre im grundständigen Bereich über Studienfachberatung, Akkreditierung und Studiengangentwicklung bis hin zu Zulassungstests für Erstsemester bis zu Erasmus habe ich inzwischen eigentlich alles gemacht.
Was hat sich denn Ihrer Meinung nach seit Ihrem Studium an der Uni Tübingen verändert, zum Beispiel bezüglich Lehr- und Prüfungsmethoden?
Es hat sich vor allem verändert, dass die Studiengänge anders sind. Mein Magisterstudium war insgesamt weniger intensiv, das hat sich mit der Umstellung auf Bachelor und Master ziemlich verändert. Früher konnte man viel studieren, wenn man wollte – und ich habe das auch gemacht – aber man konnte auch wenig studieren. Das geht heute auch noch, aber die Dichte der Lehrveranstaltungen hat sich schon deutlich verändert und es ist deutlich verschulter geworden, gerade im grundständigen Bereich. Was die Prüfungsformen angeht, ist es jetzt ein bisschen stärker diversifiziert worden. Früher war schon noch viel stärker die Hausarbeit die zentrale Form des Arbeitens, es gab wenig Praxisformate oder auch Praxisseminare oder Exkursionen. Akademische Prüfungen haben sich aber nicht grundsätzlich geändert; das Produzieren von Wissen läuft noch viel über das Schreiben von Texten.
Denken Sie, eine Transformation durch KI beginnt jetzt erst? Wie wird sich das Ihrer Ansicht nach auf Prüfungsformen wie Hausarbeiten auswirken?
Ich glaube, man sollte KI nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen; sie ersetzt aber definitiv nicht das Denken, weil sie so intelligent einfach noch nicht ist. Sie baut aus dem vielen, was sie hat, etwas zusammen, aber der kreative Prozess, neues Wissen zu schaffen, ist im Grunde noch ein weiter Schritt, der für KI im geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich zu gehen ist. Wer es sich einfacher machen will, kann sich alle Essays und Hausarbeiten zu großen Teilen über KI generieren lassen; wenn man da nochmal kritisch darüber liest und mit ein paar Literaturverweisen ergänzt, dann hat man erst mal einen präsentablen Text. Der kann aber dann natürlich auch dechiffriert werden und, ehrlich gesagt, ist man schön blöd, wenn man es macht, um eigene Leistung zu ersetzen. Es zu nutzen, um bestimmte Erfahrungen zu sammeln und vielleicht auch bestimmte Vor- und Nachteile kennenzulernen, halte ich für positiv und vielleicht kann man das in der Zukunft auch stärker einbinden. Aber ganz grundsätzlich ersetzt es eben nicht das eigene Denken. Wir wollen ja eben nicht in der Matrix als Batterie enden, sondern wir wollen ja tatsächlich selber noch denken können.
Jetzt mal zu uns Studierenden: Denken Sie, da hat sich viel verändert, seit Sie Student waren? Vor allem da Sie ja auch Studienfachberater sind, haben Sie ja viel Kontakt zu uns persönlich; wie vergleichen Sie uns als Studierende mit denen von vor 20 Jahren?
Das ist eine gute Frage, weil es ein sehr ambivalentes Bild ist. Einerseits sind die Menschen früher etwas später an die Uni gekommen, weil es, zumindest für Männer, Pflichtdienste gab und die Schule grundsätzlich ein Jahr länger war. So war ein gewisser Reifungsprozess grundsätzlich einfach schon mal weiter fortgeschritten. Das heißt, wir haben es heute mit jüngeren Menschen zu tun, die vielleicht auch in der Entwicklung doch noch nicht ganz so weit sind, was Erfahrungen angeht. Das liegt eben in der Natur der Sache. Außerdem ist es auch eine gesellschaftliche Entwicklung, dass man darauf hingewiesen wird, immer mehr erklären und überlegen zu müssen, wofür was gut ist und wofür man es verwenden kann, anstatt einfach zu machen. In der Studienberatung resultiert das vor allem in einer gewissen Verunsicherung und in einem ständigen Nachfragen, was nicht unbedingt falsch ist, sondern eher der richtige Weg. Aber manche Sachen könnte man natürlich auch selber herausfinden; das war aber auch früher schon so. Ich erlebe aber gleichzeitig, dass es – so wie früher auch – sehr viele engagierte Studierende gibt, die sehr intelligent sind. Genauso wie es welche gibt, die eher leben und nicht so sehr studieren wollen, und auch das hat sich, glaube ich, nicht groß geändert.

Bild: Max Maucher
Mit welchem Gefühl verlassen Sie nun das Institut für Politikwissenschaft? Was werden Sie vermissen, was lassen Sie gerne hinter sich?
In den letzten 20 Jahre sind immer mehr Aufgaben dazugekommen, ich war gleichzeitig mit Fachstudienberatung, Studiengangkoordination, Lehre und Akkreditierung beschäftigt, und das werde ich nicht vermissen. Das sind im Grunde drei Jobs, und das ist das Problem an unserem System: In Großbritannien zum Beispiel hätten Sie da drei bis vier Mitarbeiter, die diesen Job machen und dementsprechend auch mehr Zeit haben. Was ich aber vermissen werde, ist die Atmosphäre am IfP, die ist sehr nett und kollegial und ich war auch mit den Studierenden immer sehr kooperativ, zumindest aus meiner Sicht. Auch das Ambiente am IfP ist natürlich ein besonderes, mit der Grünfläche drumherum, der Linde, und das macht den Ort schon ein bisschen besonders. Aber ich habe die Hoffnung, dass sich das am neuen Institut für Rechtsextremismusforschung fortsetzen lässt, dass es auch ein ähnlich gutes Verhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden trotz der üblichen Konflikte gibt. Denn das macht die Uni ja auch aus: Dieser möglichst offene Diskurs, und ich hoffe, diesen etwas herrschaftsfreier gestalten zu können. Da ist es auch für mich als Politikwissenschaftler ein Anliegen, dass man versucht, ein bisschen auf Augenhöhe zu diskutieren und nicht so sehr die einzelnen Statusunterschiede in den Vordergrund zu stellen. Solche gibt es natürlich, diese sind aber hinderlich für einen offenen Diskurs. Die Zeit am IfP war sehr schön, auch wenn sie mitunter ziemlich stressig war. Aber bei mir überwiegt tatsächlich die Vorfreude auf eine neue Aufgabe, ein anders zugeschnittenes Tätigkeitsfeld, einfach mal was Neues ausprobieren.
Gibt es ein bestimmtes Forschungsprojekt am IfP, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Das Problem ist, dass Forschung für mich im Grunde immer Freizeitbeschäftigung war, das ist etwas schade. Offiziell sind 30 Prozent meiner Dienstzeit für Forschung reserviert, aber mit all den anderen Sachen, die ich machen soll, geht das nicht auch noch. Es gibt eine strukturelle Überlastung an vielen Stellen der Universität, da muss man nicht darüber jammern, aber was ich immer ganz schön fand, waren kleine Forschungsprojekte. Da gab es zum Beispiel Workshops mit Studierenden aus Russland und Deutschland, oder Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen zur Kommunalpolitik in Tübingen und Petrosawodsk, der Partnerstadt von Tübingen. Das waren sehr spannende Forschungsprojekte, weil man tatsächlich auch vor Ort viel machen konnte. Das Demokratie-Monitoring, das wir zweimal mit einer qualitativen Studie in Baden-Württemberg gemacht haben fand ich auch sehr spannend, weil es nochmal einen anderen Blick darauf gibt, wie Menschen über Politik und Demokratie reden und handeln. Ich hoffe, dass ich Zukunft wieder mehr davon machen kann.
Was macht für Sie den Reiz an der Forschung aus?
Es ermöglicht, der eigenen wissenschaftlichen Neugier nachzugehen, Dinge besser verstehen zu können, Sachen erklären zu können, die auf den ersten Blick nicht so ganz einleuchtend sind: Warum Menschen beispielsweise die direkte Demokratie ganz toll finden, aber gleichzeitig rassistisch und exkludierend sind, was ja dem Gedanken eigentlich total widerspricht. Direkte Demokratie heißt ja, alle mitmachen zu lassen, aber dann haben sie eine sehr genaue Vorstellung davon, wer eigentlich „alle“ sind. Dahinter zu kommen, was Menschen motiviert, so zu denken, ist ein Beispiel für diese Neugier. Außerdem: Wissenschaft heißt ja nicht immer nur, Wissen zu generieren, für mich ist es immer auch ein Stück weit der Transfer, also das gesellschaftlich relevante und wirksame dahinter zu finden. Das Schöne an Forschung ist, dass man, je nachdem, wie man sie macht und präsentiert, auch direkt wirken kann.
Was werden Ihre neuen Aufgaben am Institut für Rechtsextremismusforschung sein?
Dieses Institut und die Mittel dafür sind in einem Wettbewerb des Landes Baden-Württemberg vergeben worden. Es hätte eigentlich nur eine Forschungsstelle werden sollen, aber wir bestanden darauf, dass es ein Institut wird, damit es in den Forschungskontext der Universität eingebunden ist. Es wurden gerade drei W3-Professuren ausgeschrieben, es wird auch noch eine vierte Professur geben, eine wissenschaftliche und eine administrative Geschäftsführung, und dann eine ganze Reihe an Doktorandinnen und Doktoranden, und so weiter, um das Thema in der Wissenschaft stabil zu verankern. Wir haben eine institutionelle Einbindung, und die ist nicht morgen wieder weg, weil die Drittmittelfinanzierung ausläuft. Es wird also in den Landeshaushalt eingehen und bleibt auch bestehen.

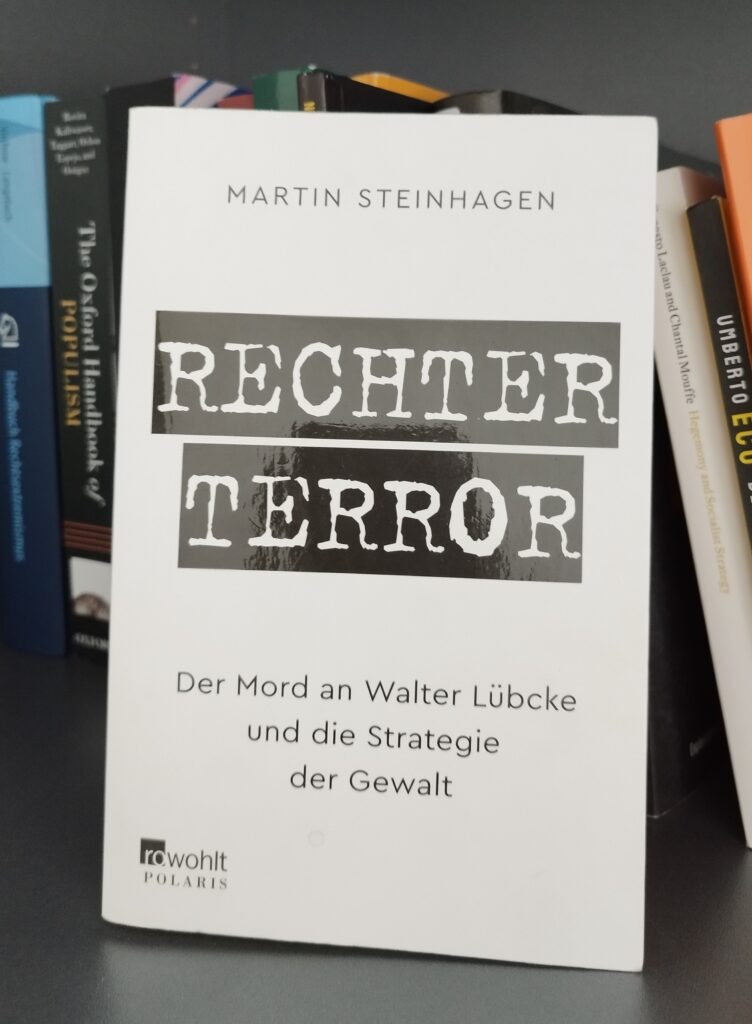
Meine Aufgabe als wissenschaftlicher Geschäftsführer, gemeisam mit meinem Kollegen Reiner Baur, der zuvor in den Erziehungswissenschaften tätig war, ist im Moment, dieses Institut administrativ und strukturell aufzubauen und eine Vernetzung mit der wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Landschaft herzustellen, damit die künftigen Professorinnen und Professoren gleich in den wissenschaftlichen Alltag einsteigen können. Eine der nächsten perspektivischen Aufgaben wird die Studiengangentwicklung sein, wir werden ziemlich sicher einen Masterstudiengang, wie z.B. „Extremismus und Demokratie“ oder so ähnlich anbieten. Zunächst wird das mit einem Weiterbildungsprogramm anfangen, aber sobald die Leute da sind, kann man an Studiengangentwicklung denken.
Es ist auch geplant, ein Rechtsextremismus-Monitoring zu machen: Das heißt zum einen regelmäßige Umfragen, aber zum anderen auch, eine Plattform aufzubauen, auf der wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungsmaterial dokumentiert werden. Es sollen Forschungsergebnisse mit räumlichen Daten und Ereignissen verbunden werden, sodass wir einen besseren Blick auf Rechtsextremismus und was wir dagegen tun können ermöglichen können. Dann kommt natürlich klassisches Forschungsmanagement dazu: Projektanträge, Projektentwicklung, Reporting, und all diese Sachen. Ein bisschen Lehre darf ich auch noch machen, das ist sehr schön. Ich werde weiterhin für das IfP das Lehrforschungsprojekt und die Vorlesung zur Empirischen Politikforschung betreuen.
Sind die Lehrveranstaltungen zum Thema Rechtsextremismus nur auf den Masterstudiengang bezogen?
Es ist so, dass das Institut für Rechtsextremismusforschung ein interdisziplinäres Institut zusammen mit der Medienwissenschaft, der Erziehungswissenschaft und anderen Fächern ist. Die Lehrangebote sollen dann natürlich an all diese Fächer zurückgespielt werden. Man kann sich das wie bei den Wahlbereichen im Bachelor und Master vorstellen. Bei dem Umfang von diesen Kursen müssen wir noch schauen, dass diese mit dem Masterstudiengang zusammen, nicht zu umfangreich werden: Mit vier Professuren hat nämlich ein relativ kleines Institut einen eigenen Studiengang. Das Problem dabei ist, dass man damit eigentlich viel zu viel Lehre hat. Und wir wollen das Thema breiter setzen, gerade in Verbindung mit Demokratie, mit der Öffentlichkeitsarbeit, aber eben auch mit bildungswissenschaftlichen Fragen. Es wäre sehr hilfreich, wenn man dann in diesen Fächern auch lehren könnte. Andererseits würden diese ebenso von einem solchen Lehrangebot profitieren.

Wie blicken Sie als Politikwissenschaftler auf die Politik und wie sehen sie das Verhältnis zwischen Politik und Politikwissenschaft?
Das ist eine sehr spannende Frage. Politik ist ein Thema, zu dem jeder etwas zu sagen hat. Und alle meinen ganz genau zu wissen, wie Politik funktioniert oder eben nicht. Das ist wie beim Fußball: Wir haben ganz viele Bundestrainerinnen und Bundestrainer, die auch ganz genau meinen, zu wissen, was unser derzeitiger Bundestrainer alles falsch macht. Das macht es ein bisschen schwierig, sich als Politikwissenschaftlerin oder Politikwissenschaftler zu positionieren. Ich habe manchmal gar keine Lust, mich in solche Alltagssituationen einzumischen, vor allem wenn das Diskussionsthema nicht mein spezifisches Feld ist. Ich habe da zwar oft ein paar Erklärungsansätze im Hintergrund, die funktionieren würden, die will aber sowieso keiner wissen. Ich mische mich dann ein, wenn mir irgendwas grob gegen den Strich geht oder wenn etwas grob fahrlässig oder falsch diskutiert wird. Ansonsten ist der analytische Blick natürlich ein anderer als der Alltagsblick. Manchmal hat man den einen, manchmal den anderen. Der emotionale, selbst-betroffene Blick ist bei mir auch nicht anders als bei Anderen. Dann kann es auch mal heiß in der Diskussion werden. Aber wenn man einen analytischen Blick auf Politik wirft, dann kann man sich vieles geraderücken, was so polemische Debatten betrifft. Dann kann man sich da zurücknehmen, und sagen: Kein Wunder, dass dies oder jenes passiert.
Was die Politik betrifft, bin ich manchmal tatsächlich ein bisschen irritiert darüber, wie wenig politikwissenschaftliche Kompetenz wirklich genutzt wird, um bessere Politik zu machen, im Sinne von fundiertem Wissen. Es wird selten geschaut, ob es Studien dazu gibt, die man verwenden kann, um Politik in die eine oder die andere Richtung zu entwickeln; da gibt es definitiv ein Übersetzungsproblem. Die Akademie hat ihre eigene Sprache und ihre eigene Logik, und die will in politische Logik der Überzeugung von Mehrheiten übersetzt werden. Aber das können wir Politikwissenschaftler auch nicht alle, beziehungsweise, das können wir teilweise besser und schlechter und manche wollen das auch nicht unbedingt. Insofern ist es gar nicht so verwunderlich, dass man manchmal aneinander vorbeiredet. Das ist natürlich aber auch sehr schade.
Mit dem neuen Institut für Rechtsextremismusforschung haben wir uns aber genau das stärker zum Ziel gesetzt: Wir wollen versuchen, diesen Praxistransfer zu erforschen. Dazu soll es eigene Forschungsprojekte geben, um zu schauen, wo der Transfer gelingt und wo nicht. Dies ist zwar nur für das spezifische Forschungsfeld zum Rechtsextremismus vorgesehen. Aber man kann die Erkenntnisse natürlich übertragen und generelle Schlüssel für mehr Interaktion zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ziehen.
Wir danken Ihnen für das Gespräch!
Sehr gerne!
Das Interview führten Max Maucher und Janne Geyer, unter Mitarbeit von Marcel Gnauck.
Beitragsbild: Max Maucher




Danke für dieses schöne Interview!
Franki4ever <3