Seit nunmehr fünf Monaten haben trans Personen in Deutschland die Möglichkeit, ihren Geschlechtseintrag und offiziellen Namen (weitestgehend) unkompliziert ändern zu lassen. Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, wurde hart erstritten und ist kein halbes Jahr nach Inkrafttreten bereits in Gefahr. Ein Kommentar.
Der steinige Weg zur gesetzlichen Selbstbestimmung von trans Personen beginnt mit dem Kampf der Schwulen und Lesben um Gleichberechtigung, also mit Stonewall. Die berühmten Stonewall Riots fanden im Juni 1969 statt und gingen vom Stonewall Inn aus, der namensgebenden New Yorker Gay-Bar. Eine Zeit, als in den USA queere Menschen, die nicht in das normative Bild von Sexualität, Geschlecht und Selbstentfaltung passten, politisch verfolgt und drangsaliert wurden. Immer wieder mussten Besucher*innen von Szenelokalen gewaltvolle Polizeirazzien erdulden.
Als die Polizei in der Nacht auf den 28. Juni erneut das Stonewall Inn stürmte, leisteten die etwa 200 Anwesenden Widerstand, was in eine Straßenschlacht mit der Polizei mündete. In den darauffolgenden Wochen und Monaten erhielt das US-amerikansiche Gay Rights Movement einen immensen Aufschwung, was über die Jahre international zu einer höheren gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwulen, Lesben und Drag Queens führte – auch zugunsten von trans Personen.
Akt I: Die Grundlage der heutigen Selbstbestimmung
In Deutschland fand die erste gesetzliche Änderung, die die Benachteiligung von trans Personen in Angriff nahm, 1981 statt. Ermöglicht wurde dies drei Jahre zuvor durch einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG). Dort hatte eine trans Frau eine Verfassungsbeschwerde erhoben, weil sie trotz geschlechtsangleichender Operation aufgrund ihres männlichen Geschlechtseintrags weiterhin auch ihren männlichen Vornamen tragen musste. Damals war es durch das damalige Personenstandgesetz (PStG) bereits möglich, Einträge in den noch analogen Personenstandsbüchern zu berichtigen.

Das BVerfG entschied, dass die Formulierung im PStG auch eine Berichtigung von Angaben ermögliche, die bei der Eintragung noch (formal) korrekt waren und erst später falsch wurden. Damit hatten trans Personen also einen Rechtsanspruch auf nachträgliche Änderung der Registereinträge. Zur gesetzlichen Regelung beauftragte das BVerfG die damalige Bundesregierung, ein neues Gesetz zu schaffen, welches 1981 schließlich in Kraft trat. Das Transsexuellengesetz (TSG) war geboren.
Dieses Gesetz ermöglichte zwar erstmalig eine teilweise Selbstbestimmung von trans Personen, diese war jedoch an äußert hohe Hürden gebunden, die mit sehr viel Marginalisierung und Diskriminierung einhergingen. So mussten trans Personen eine Änderung des eingetragenen Namens und Geschlechts weiterhin gerichtlich erwirken. Das war nicht nur mit Verfahrenskosten im vierstelligen Bereich verbunden, sondern auch mit gleich zwei medizinisch-psychologischen Gutachten, da Transgeschlechtlichkeit, wie zuvor Homosexualität, damals als psychische Erkrankung („Transsexualismus“) gewertet wurde.
Für diese ebenfalls keineswegs kostenlosen Gutachten mussten trans Personen nicht nur bereits geschlechtsangleichende operative Maßnahmen vollzogen haben, sondern sich auch übergriffige und erniedrigende Fragen zu ihren sexuellen Vorlieben, ihrem Masturbationsverhalten und ihrer Unterwäsche gefallen lassen. Die Pflicht operativer Maßnahmen wurde erst 2011 durch das BVerfG abgeschafft. War eine trans Person vor der Änderung ihres Geschlechtseintrags verheiratet, war die Ehe nach der Änderung automatisch aufgelöst.

Das Verhältnis konnte die trans Person dann, und das auch erst seit 2009, in Form einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft fortführen. Bis 2011 musste sie sich dafür sogar noch zusätzlich sterilisieren lassen. Die Prozedur von Gutachten und Gerichtsverfahren blieb allerdings erhalten – bis vor kurzem.
Akt II: Allmähliche Verbesserung
Wir schreiben nun das Jahr 2018, das TSG wird schon seit geraumer Zeit von queeren Verbänden vehement kritisiert und abgelehnt. Bereits 2012 hat der im Jahr zuvor gegründete Bundesweite Arbeitskreis TSG-Reform in einem Positionspapier gefordert, das Gerichtsverfahren zur Änderung von eingetragenem Namen und Geschlecht abzuschaffen und Krankenkassen zur Kostenübernahme geschlechtsangleichender Maßnahmen gesetzlich zu verpflichten. Das Ganze solle man über bestehendes Recht regeln und das TSG aufheben.
Jetzt geht es für politische Verhältnisse Schlag auf Schlag: Auf einen Beschluss des BVerfG hin führt die Bundesregierung mit § 45b PStG den dritten Geschlechtseintrag „divers“ ein. Der Verfassungsbeschwerde über den fehlenden dritten Eintrag ist allerdings nur aufgrund der Intergeschlechtlichkeit (auf Amtsdeutsch „Variante der Geschlechtsentwicklung“) der beschwerde-führenden Person stattgegeben worden; das zu diesem Zeitpunkt immer noch geltende TSG geht weiterhin von einer Binarität des sozialen Geschlechts aus.

Daher können nur inter Personen über § 45b ihren Geschlechtseintrag in „divers“ und damit einhergehend auch ihren Realnamen ändern lassen – offiziell zumindest, denn vereinzelten Berichten zufolge haben es auch einige nichtbinäre Personen geschafft, Standesbeamte davon zu überzeugen, dass der Beschluss des BVerfG sich auf das soziale, nicht (nur) das biologische Geschlecht bezieht.
Akt III: Ein wesentlicher Fortschritt…
Nachdem erst 2017 die Bundestagsfraktion der Grünen und dann 2021 jeweils die der Grünen und die der FDP erste Gesetzesentwürfe vorgebracht haben, ist das Ziel 2022 endlich in Reichweite, als die Bundesregierung dem Bundestag ein Eckpunktepapier mit groben inhaltlichen Zielen für ein neues Selbstbestimmungsgesetz vorlegt. Im Jahr darauf veröffentlicht das Bundesfamilienministerium einen Regierungsentwurf für das jetzige Gesetz zur Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG), der schließlich weitere 11 Monate später beschlossen wird und im November 2024 offiziell in Kraft tritt.
Dadurch können wir trans Personen nun die amtlichen Einträge über Name und Geschlecht selbstbestimmt und für bürokratische Verhältnisse unkompliziert ändern. Ein einfacher Gang zum Standesamt (mit dreimonatiger Vorlaufzeit) und 60€ Bearbeitungsgebühr (mit neuer Geburtsurkunde 80€) reichen mittlerweile aus.
Über den Beschluss des SBGG reagierten die queeren Verbände dennoch mit eher zurückhaltender Freude. Zwar wurde die bürokratische und finanzielle Hürde der Gerichtsverfahren sowie die psychologischen Gutachten des TSG abgeschafft und sogar das dort bereits enthaltene Offenbarungsverbot des alten Geschlechts und Namens durch Dritte wurde ausgeweitet. Allerdings sind die Hürden für die Kostenübernahme geschlechtsangleichender Maßnahmen durch die Krankenkassen nach wie vor enorm hoch und kaum reguliert. Darüber hinaus gibt es vorrangig zwei Kritikpunkte an dem Gesetz.
…mit einigen bitteren Pillen
Zum einen sollen transfeminine Personen als Männer ins Militär eingezogen werden, wenn sie zwei Monate oder weniger vor Eintritt eines Spannungs- oder Verteidigungsfalles ihren Geschlechtseintrag geändert haben (§ 9). Diese Regelung soll vorgeblich die Kriegsdienstvermeidung von cis Männern durch missbräuchliche Verwendung des SBGG verhindern, ist jedoch völlig unnötig, da auch Männer jederzeit den Dienst an der Waffe verweigern können. Zwar nicht ersatzlos, aber käme es auf den zivilen Ersatzdienst an, stünde das wohl so im Gesetzestext. Zumal man dann auch cis Frauen zum Zivildienst zwingen müsste, aber das würde wohl kaum noch in das patriarchale Gesellschaftsbild passen.

Zum anderen ist da der juristisch noch obsoletere Hinweis, dass sich das SBGG nicht auf das Hausrecht in Bezug auf den Zugang zu Räumen, Einrichtungen und Veranstaltungen auswirkt (§ 6 Abs. 2). Diesen Absatz ist der FDP, namentlich dem früheren Justizminister Marco Buschmann, zu verdanken. Dieser zögerte die Vollendung des Regierungsentwurfs (der vorletzte Schritt vor dem Beschluss im Parlament) monatelang hinaus. Als Rechtfertigung äußerte Buschmann 2023 Bedenken über Männer, die sich mithilfe eines weiblichen Geschlechtseintrags auf legale Weise Zugang zu Frauensaunen oder -fitnessstudios verschaffen könnten.
Kein Witz. Und das von einem Justizminister. Gerade der sollte doch Wissen, dass für dieses Szenario nur das Hausrecht des Eigentümers sowie die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gelten und amtliche Dokumente darauf keinerlei Einfluss haben.
Sowohl § 6 Abs. 2 als auch § 9 SBGG ändern in der Praxis rein gar nichts. Das selbstverständlich vom SBGG unangetastete Hausrecht dennoch explizit zu betonen (noch dazu ohne Erwähnung des AGG) basiert auf das völlig irre Schreckensszenario eines möglichen Missbrauchs des Gesetzes. Das Gleiche gilt auch für das Heranziehen transweiblicher Personen zum Wehrdienst, wenn diese ihren Geschlechtseintrag nicht früh genug geändert haben. Rechte für insbesondere trans Frauen werden dadurch mindestens als potenzielle Gefahr für die Gesellschaft dargestellt und trans Frauen, welche selbst besonders häufig von Gewalt betroffen sind, unter Generalverdacht gestellt.

Dieses Framing stärkt das transfeindliche Narrativ, trans Frauen seien ja auch nur ‚Männer in Kleidern‘, spielt also rechten Demagogen in die Karten. Doch nicht nur das, die vermeintliche, inszenierte Notwendigkeit dieser Formulierungen ist auch ein trauriges Zeugnis der Symbol- und Appeasementpolitik der ehemaligen Regierung. Eine Regierung, bestehend aus Parteien, die allesamt möglichst progressiv wirken wollen und es dabei doch nicht lassen können, rechte Narrative zu verstärken, um vielleicht doch noch den einen oder anderen Unionswähler herumzubekommen. Alles, was man damit macht, ist menschenfeindliches Gedankengut im politischen Mainstream zu etablieren und somit die Grenze des Sagbaren nach rechts zu verschieben.
In einer Pressemitteilung führt der Bundesverband Trans* den, unter Umständen stattfindenden Einzug von trans Frauen ins Militär, sowie die überflüssige Erwähnung des Hausrechts gegenüber trans Personen auf die transfeindlichen Desinformationskampagnen zurück, die seit der Veröffentlichung des SBGG-Eckpunktepapiers im Sommer 2022 stattfanden. Diese Kampagnen scheinen erst seit diesem Jahr allmählich abzunehmen – ganz im Gegenteil zu Queerfeindlichkeit, die wieder steigt.
Dass unter demselben Deckmantel, Straftätern zuvorkommen zu wollen, in einem früheren Entwurf des jetzigen Selbstbestimmungsgesetzes noch eine Übermittlung sämtlicher Daten aus dem Personenstandsregister an die Strafverfolgungsbehörden angedacht war nach Änderung des Geschlechtseintrags, ist ebenso kennzeichnend für die repressive Verteidigung patriarchaler Machtstrukturen wie die zuvor genannten Punkte. Diese Regelung konnte erst der öffentliche Druck und auch das wohl nur knapp verhindern.
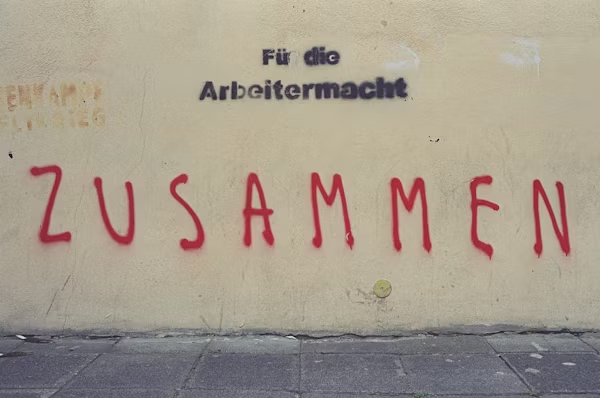
Akt IV: Das Gesetz ist sicher.. oder?
Apropos verhindern. Die Union, auch bekannt für das sture Verhindern gesellschaftlichen Fortschritts, hat bereits letztes Jahr unmittelbar nach Beschluss des SBGG angekündigt, selbiges 2025 direkt wieder rückabwickeln zu wollen. Als Begründung nennt die damalige Fraktionsvorsitzende Andrea Lindholz, ein Mann könne Schutzräume für Frauen einfach so betreten, indem er behaupte, er sei eine Frau. Dass das SBGG darauf keinerlei Einfluss hat, weil amtliche Dokumente in diesem Szenario keinerlei Rolle spielen, ist egal. Das Gesetz ist lediglich Anlass, Narrative organisierter politischer Transfeindlichkeit zu pushen und reaktionären Kräften Aufschwung zu verschaffen – inklusive sich selbst. Nicht vergessen: Konservative waren die Steigbügelhalter der Nationalsozialisten.
Wie der gegenwärtige vierte Akt ausgehen wird, ist zwar noch ungewiss, doch ist die Erklärung der Unionsfraktion, das Gesetz zumindest teilweise abschaffen zu wollen, als Drohung durchaus ernst zu nehmen. Umso härter gilt es, das bestehende Gesetz zu verteidigen und weiterhin Druck für eine Streichung der entsprechenden Paragraphen zu machen. Sich aus purer Resignation mit Marginalverbesserungen zufrieden zu geben, führt auf lange Sicht zu vorauseilendem Gehorsam gegenüber einem stetig nach rechts rückenden politischen System, schafft Narrenfreiheit für Menschenfeinde und damit die perfekten Konditionen für den Faschismus.
Letztendlich zeigt sich wieder einmal: Nachhaltige Selbstbestimmung wird nicht von den Herrschenden reformistisch erlassen, sondern muss immer wieder erkämpft werden. Oder um es mit einer linken Parole zu sagen: Nicht auf diesen Staat vertrauen, Gegenmacht von unten bauen!
Beitragsbild: Alexander Grey auf Unsplash.





Cooler Text vom mein Lieblingsmensch ganz viel liebe geht naus