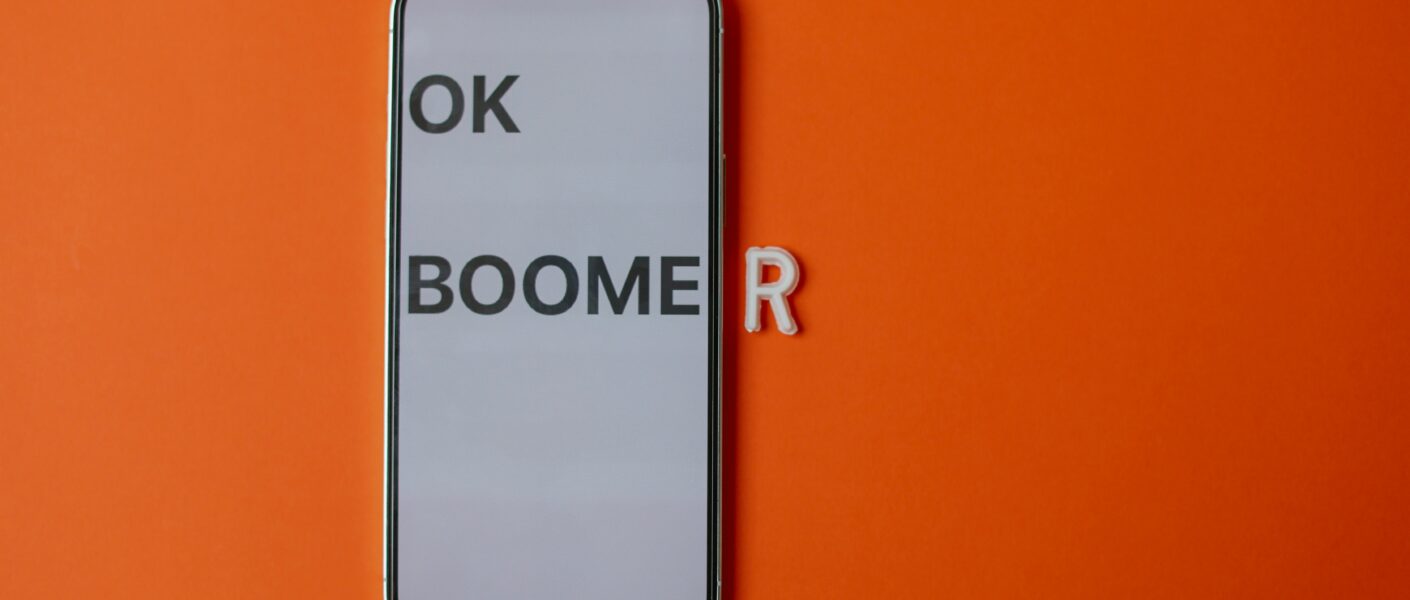Wenn Klartext zur Pose wird und Empörung als Beweis gilt, ist Stromberg nicht weit. Der neue Film verfolgt eine Haltung, die sich durch Politik, Medien und Alltag zieht – und fragt, warum sie so widerstandsfähig ist. Ein Essay über Stromberg, Merz, Palmer und öffentliche Sprache.
Manchmal kehren Figuren nicht zurück, weil sie vermisst werden, sondern weil sie sich hartnäckig weigern, zu verschwinden. Stromberg gehört zu diesen Untoten der deutschen Gegenwart. Stromberg – Wieder alles wie immer von Arne Feldhusen und Ralf Husmann ist deshalb kein nostalgisches Klassentreffen und schon gar kein sentimentales „Weißt du noch?“, sondern ein Testlauf unter verschärften Bedingungen: Hält die Figur die Realität von heute aus – oder hält die Realität ihm stand? Die Antwort ist unangenehm eindeutig. Stromberg wirkt nicht wie ein Relikt aus einer anderen Epoche, sondern wie jemand, der nur kurz draußen war, um sich Zigaretten zu holen.

Der Film ist klug genug, sich selbst nicht zu trauen. Er weiß, dass Stromberg heute eigentlich nicht mehr funktionieren dürfte – und setzt genau darauf. Also wird die Figur nicht einfach reaktiviert, sondern unter Beobachtung gestellt: zurückgeholt von einer Reality-Produktion, eingerahmt von Kameras, Triggerwarnungen und einer Gegenwart, die sich permanent selbst erklärt. Stromberg stolpert durch diese neue Welt wie ein Mann, der ernsthaft fragt, ob das jetzt wirklich nicht mehr gesagt werden darf. Oder ist die eigentliche Frage nicht längst eine andere: Warum sagen es manche immer noch – und wundern sich dann über die Reaktionen?
Wenn Satire zur Realität wird
Spätestens hier verlässt der Film endgültig den Raum der Fiktion. Denn was Stromberg sagt, klingt nicht mehr wie ausgedacht, sondern wie aus der Nachrichtenlage übernommen. Hier kann an Friedrich Merz gedacht werden, der in Interviews Sätze sagt, die vor wenigen Jahren noch als zugespitzt satirisch betrachtet wurden: von Frauen, die ihn im Aufzug „schwerer“ machten, von Ausländern, die „nicht arbeiten wollen“, oder von dem politischen Bedürfnis, dass früher oder später auch mal „Rambozambo“ sein dürfe. Dies weckt bekannte Erinnerungen… Nur eben mit Krawatte statt Kaffeebecher?
Merz’ berühmte Mitgliedschaft im „Verein für deutliche Aussprache“ funktioniert exakt nach strombergscher Logik: erst der Spruch, dann das Erstaunen über die Empörung, anschließend die Erklärung, es sei doch „nicht so gemeint“. Und wenn die Erklärung die Lage verschlimmert – umso besser. Lernfähigkeit gilt in diesem System nicht als Tugend, sondern als Schwäche. Warum etwas überdenken, wenn die Aussage korrekt war?
Unbelehrbarkeit als Haltung
Stromberg ist in diesem Film kein Einzelfall mehr, sondern ein System. Er steht für einen Männertypus, der sich für authentisch hält, weil er ungefiltert spricht und für mutig, weil er keine Rücksicht nimmt. Einer, der Verwechslungen für Wahrheiten hält und Beleidigungen für Klartext. Einer, der ernsthaft glaubt, das Problem liege nicht in seinen Worten, sondern in der mangelnden Robustheit der Welt. Was ist schon Sensibilität, wenn auch einfach seine Meinung gesagt werden kann?

Der Film macht sich darüber nicht lustig, indem er überzieht, sondern indem er exakt bleibt. Stromberg scheitert nicht an Verboten, sondern an seinem Unwillen, die Wirkung des eigenen Sprechens mitzudenken. Er ist nicht missverstanden – er versteht nicht. Und genau deshalb ist er so beunruhigend vertraut.
Tübingen ist überall
Wer glaubt, diese Dynamik sei ein Berliner Problem, muss nur nach Tübingen schauen. Boris Palmer, Oberbürgermeister, notorischer Grenzgänger, erklärte auf einer Konferenz mehrfach das Wort, das nicht gesagt wird – und wunderte sich anschließend über den Eklat. Protest von Studierenden, Widerspruch von Wissenschaftlern, Empörung im Saal. Palmers Reaktion folgte dem bekannten Drehbuch: Verteidigung, Opferpose, Eskalation. Der Vergleich der eigenen Situation mit der Judenverfolgung im Nationalsozialismus setzte dem Ganzen die groteske Krone auf. Wie entstehen solche Gedanken – und warum werden diese für sagbar gehalten?
Erst später kam die Einsicht. Oder zumindest ihre sprachliche Simulation. Palmer erklärte, er habe „alles nur schlimmer gemacht“, er fühle sich missverstanden, er müsse an sich arbeiten, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Diese Sätze werden oft gehört und ebenso oft stellen sich die Fragen: Warum immer erst danach? Warum nie vorher? Stromberg hätte es kaum anders formuliert – vielleicht nur weniger reuig.
Die ritualisierte Einsicht danach
Was Merz und Palmer verbindet, ist kein Parteibuch und kein politisches Programm, sondern ein bestimmtes Selbstverständnis. Beide sprechen, als sei die Öffentlichkeit ein Raum, in welchem vor allem die eigene Treue zähle. Die Reaktion der anderen gilt dabei als nachrangig, fast als Störung. Wenn Empörung entsteht, wird sie nicht als Hinweis verstanden, sondern als Beweis für die eigene Standhaftigkeit. Ist dies Unbelehrbarkeit oder einfach nur Konsequenz?
Stromberg beherrscht diese Logik perfekt. Er sagt etwas, das verletzt, wundert sich über die Verletzten und erklärt anschließend, dies müsse auch mal ausgehalten werden können. Dass Aushalten immer die anderen betrifft, fällt ihm dabei nicht auf. Oder es interessiert ihn nicht. Der Film zeigt diese Haltung nicht als Skandal, sondern als Routine. Und gerade darin liegt seine Komik: im unerschütterlichen Glauben daran, dass der eigene Tonfall eine Art Naturgesetz sei.
Lachen aus Wiedererkennung
Christoph Maria Herbst nähert sich Stromberg nicht mit Übertreibung, sondern mit sezierender Präzision. Er macht aus der Figur kein groteskes Monster, sondern einen Mann, der sich in seiner Rolle eingerichtet hat. Jede Kamerapause, jedes halbwissende Lächeln, jedes nachgeschobene „war doch nicht so gemeint“ sitzt millimetergenau. Stromberg weiß, dass er gleich etwas Falsches sagen wird – und sagt es trotzdem. Vielleicht gerade deshalb. Ist das noch Provokation oder schon Gewohnheit?
Das Komische entsteht hier nicht aus Lautstärke, sondern aus Wiedererkennbarkeit. Es wird erkannt, diese Blicke, diese Sätze, diese Art, Verantwortung als Missverständnis umzudeuten. Weil es gut gespielt ist, wird gelacht – und kurz darauf verstummt, weil es allzu vertraut wirkt. Herbst spielt Stromberg nicht als Ausnahme, sondern als Wirklichkeit. Und genau das macht die Figur so wirksam.
Das Lachen, das bleibt
Dass der Film heute so mühelos funktioniert, liegt nicht an nostalgischer Verklärung, sondern an der Beharrlichkeit bestimmter Haltungen. Während überall von Sensibilität, Lernprozessen und neuen Kommunikationskulturen die Rede ist, treten immer wieder Figuren auf, die davon nichts wissen wollen. Oder nichts wissen müssen. Sie sprechen von Klartext, meinen aber Gewohnheit. Sie berufen sich auf Meinungsfreiheit, wenn sie eigentlich Widerspruchsfreiheit erwarten. Hat sich die Gesellschaft verändert – oder nur die Geduld der anderen?
Der Film hält dieser Gegenwart keinen Spiegel vor, er stellt ihr eine Figur hinein und schaut zu, was passiert. Und was passiert, ist unerquicklich vertraut. Stromberg scheitert nicht an Regeln, sondern an seiner Weigerung, Wirkung anzuerkennen. Er bleibt stehen, während sich alles um ihn herum bewegt – und erklärt das zur Standhaftigkeit.

Stromberg – Wieder alles wie immer ist deshalb keine Rückkehr, sondern eine Bestandsaufnahme. Der Film fragt nicht, ob heute noch über Stromberg gelacht werden darf. Er zeigt, dass bereits wieder über ihn gelacht wird – weil er längst wieder da ist. Im Kanzleramt, im Rathaus, auf Podien, in Talkshows und in Männerpodcasts. Überall dort, wo Menschen reden, ohne zuzuhören, erklären, ohne zu verstehen und standhaft bleiben, weil Bewegung anstrengend wäre. Ist Stromberg also das Problem – oder nur die ehrlichste Figur dieser Gegenwart?
Das Lachen, das dieser Film auslöst, ist kein befreiendes. Es ist ein Lachen mit Nebengeräusch. Eines, das hängen bleibt, weil es eine unbequeme Wahrheit transportiert: Nicht alles, was alt ist, verschwindet. Manches wird einfach wieder eingeladen. Und nennt sich dann Comeback.
Beitragsbild: Cup of Couple auf pexels